1. Welches sind die Grundlagen zum Schriftspracherwerb in Thüringen?
Im Jahr 2004 hat die Kultusministerkonferenz der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) Bildungsstandards im Fach Deutsch für die Jahrgangsstufe 4 des Primarbereichs beschlossenen.
Diese bilden u. a. die Grundlage des Thüringer Lehrplans für das Fach Deutsch in der Grundschule.
Der Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre (Stand von 2010) beschäftigt sich in Kapitel 2.1 mit der sprachlichen und schriftsprachlichen Bildung. Hier wird betont (S. 46f.):
"Der gelingende Schriftspracherwerb ist notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche Bildungsbiographie und für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben."
2. Welche Schrift erlernen die Kinder an Thüringer Schulen?
In dem Thüringer Lehrplan für das Fach Deutsch in der Grundschule von 2010 werden folgende Zielbeschreibungen genannt:
1. Nach der Schuleingangsphase können die Schüler flüssig, formklar und leserlich in Druckschrift schreiben.
2. Am Ende der Klassenstufe 4 können die Schüler mit einer gut lesbaren individuellen Handschrift formklar, flüssig und in angemessenem Tempo schreiben.
Druckschrift knüpft durch ihre Präsenz im Alltag und in der Öffentlichkeit an vorschulische Erfahrungen der Kinder an und begünstigt damit auch den Leselernprozess. Daher wird an Thüringer Grundschulen die Druckschrift als Erstschrift unterrichtet.
Wenn das Kind die Druckschrift beherrscht, führt der Lehrer oder die Lehrerin es in eine verbundene Schreibschrift ein. Daraus entwickelt das Kind seine individuelle Handschrift weiter. Die Auswahl der Schrift und der Methoden liegt dabei in Verantwortung der Einzelschule und des jeweiligen Pädagogen.
Dabei ist im Sinne der individuellen Förderung auf die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schüler und ihr jeweils individuelles Lerntempo einzugehen und Methoden sowie der Zeitpunkt ihres Einsatzes mit Bedacht auszuwählen.
3. Weshalb ist das Erlernen der Druckschrift als Erstschrift wichtig?
Druckschrift ist im Alltag, in der Öffentlichkeit präsent. Kinder haben in der Regel vor der Einschulung schon Erfahrungen mit Druckschrift gemacht und bringen diese Erfahrungen mit in die Schule.
Die Buchstaben der Druckschrift stehen unverbunden nebeneinander und verändern sich auch nicht. Sie sind wahrnehmungsmäßig leichter isolierbar. Dies ist dem kindlichen Auffassungs- und Darstellungsvermögen angemessen. Die Buchstaben der Druckschrift entsprechen weitgehend denen der gedruckten Schriften.
Druckschrift zeichnet sich durch prägnante Schriftzeichen und Wortbilder aus. Damit wird das gliedernde Erfassen der Schrift gefördert sowie das Erlernen der Rechtschreibung begünstigt.
Druckschrift ist für den Schreibbeginn schreibmotorisch einfacher. Sie besteht lediglich aus zwei Grundformen, aus denen sich alle Groß- und Kleinbuchstaben zusammensetzen. Durch das frühzeitige Schreiben mit Druckschrift wird die Feinmotorik auf die spätere individuelle Handschrift vorbereitet.
Lesen und Schreiben unterstützen sich wechselseitig. Druckschrift gestattet, Lesen- und Schreibenlernen an einem Zeichensystem durchzuführen. Druckschrift ermöglicht eine inhaltliche und zeitliche Synchronisierung von Lese- und Schreiblehrgang. Druckschriftschreiben wird damit eine wichtige leseunterstützende Maßnahme. Kinder schreiben und lesen ihre eigenen Wörter, Sätze, Geschichten. Dies kommt der Lernbereitschaft der Kinder entgegen, vermittelt Erfolgserlebnisse und fördert die Motivation für das Lesenlernen.
Die Druckschrift als Ausgangsschrift erfüllt alle Anforderungen an eine funktionale Schrift.
4. Wie kann der Übergang von der Druckschrift zu einer gut lesbaren, individuellen Handschrift gelingen?
Da Schulanfänger sich auf ganz unterschiedlichen Wegen zur Schrift befinden, ist die Be-stimmung der Lernausgangslage für jeden einzelnen Schüler notwendig.
Der Schüler beginnt in der Grundschule mit der Druckschrift als Erstschrift, zunächst in Großbuchstaben und anschließend auch in Verbindung mit Kleinbuchstaben. Oft werden die Groß- und Kleinschreibung der Buchstaben zeitgleich eingeführt. Beim Schreiben der Druckschrift lernt und übt der Schüler Bewegungsabläufe, den Formaufbau sowie die Stift- und Körperhaltung unter Anleitung. Somit schafft das Druckschriftschreiben als Erstschrift die Voraussetzungen für eine formstabile und gut lesbare individuelle Handschrift.
Voraussetzung für eine gelingende Schrift sind die gezielte Steuerung der Handbewegung und einer entsprechenden Fingerbeweglichkeit sowie ein Gespür für das Material, auf das geschrieben wird. Aus diesem Grund werden grafomotorische Übungen vorangestellt und begleiten den Schreiblernprozess. Diese Übungen beinhalten auch die Grundelemente der Druck- und Schreibschrift.
Wenn der Schüler den Druckschriftlehrgang abgeschlossen hat, erlernt er eine verbundene Schrift. Da eine verbundene Schreibschrift erhöhte Anforderungen an die Feinmotorik der Hand stellt, macht der Thüringer Lehrplan keine Vorgaben zum Zeitpunkt des Übergangs zur Schreibschrift. Dieser orientiert sich am Lernprozess des einzelnen Schülers.
Die Buchstaben der Schreibschrift mit gleichen und ähnlichen Formen werden zu Übungs-einheiten zusammengefasst. Buchstabenverbindungen werden geübt und dabei die Größe, die Abstände sowie die Formen beachtet. Die Schreibhaltung und die Handhabung des Füllers wird mit jedem einzelnen Kind geübt. Der Schüler entdeckt, findet und erprobt die Bewegungsabläufe in der Schreibschrift in vielfältigen Übungsphasen. Danach kann er in der ihm zur Verfügung gestellten Zeit seine Schreibschrift individuell weiter entwickeln.
Das Schreiben einer individuellen Handschrift verlangt vom Schüler bewusste Formwahrnehmung, die Beherrschung des Schreibgerätes und ausdauernde Übung und Zeit. Die Entwicklung einer individuellen Handschrift ist mit der Grundschulzeit nicht abgeschlossen. Dies sollte an der weiterführenden Schule beachtet werden.
Die Auswahl der Schrift und der Methoden liegt in Verantwortung der Einzelschule und des jeweiligen Pädagogen.
Prinzipiell sind die individuellen Schreibleistungen der Kinder zu würdigen.
5. Was ist bei dem Lernen der Rechtschreibung zu beachten?
Mit Beginn der Grundschulzeit gewinnt der Schüler, aufbauend auf seinen Vorkenntnissen, Einsichten in den Aufbau und die Struktur der Sprache. Gleichzeitig werden Sprache und Schriftsprache zum konkreten Gegenstand der Betrachtung im Unterricht.
Der Schüler entwickelt eigene Schreibideen und kann diese unter Verwendung verschiedener sprachlicher Mittel umsetzen. Dabei erfährt er die Bedeutung des richtigen Schreibens im Sinne der Entwicklung von Rechtschreibbewusstsein und Fehlersensibilität.
Dies gelingt insbesondere, wenn im Deutschunterricht von Anfang an das eigene Entdecken des Schülers gefördert und zugleich die rechtschreibliche Norm als Arbeitsperspektive eingebunden wird. Der Unterricht ist demzufolge sowohl kind- als auch normorientiert.
Die Zielsetzung des Thüringer Lehrplans für die Schuleingangsphase ist die richtige Schrei-bung lautgetreuer Wörter und die Anwendung erster Rechtschreibmuster, wie zum Beispiel das Einhalten von Wortgrenzen, die Groß- und Kleinschreibung, die Zeichensetzung (Punkt, Ausrufezeichen, Fragezeichen).
Ferner erfolgt die frühzeitige Einführung von Arbeitstechniken, beispielsweise
-
Nachschlagen von Wörtern nach Anleitung und Nutzung von Rechtschreibhilfen (z.B. Wörterbuch oder Computerprogramme),
-
Kommentierung der Schreibweise von Wörtern,
-
Abschreiben, Nachschreiben, Kontrollieren, Berichtigen.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass der Schüler in vielfältigen selbstständigen und angeleiteten Übungssituationen seinen individuellen Wortschatz, den Schreibwortschatz und den Klassenwortschatz für das Schreiben von Wörtern, Sätzen und Texten nutzt und festigt sowie Überarbeitungsmöglichkeiten kennenlernt. Dabei erfährt er die Bedeutung des richtigen Schreibens.
Im Prozess des Schriftspracherwerbs werden Erklärungen zu schriftsprachlichen Strukturen dem Lernstand des Schülers angepasst.
Sobald der Schüler im lautorientierten Schreiben sicher ist, kann er orthografische Regelmäßigkeiten bewusst wahrnehmen und seine Texte selbstständig überarbeiten.
Dieser Zeitpunkt kann von Schüler zu Schüler unterschiedlich sein.
Die Auswahl der Konzepte, Methoden und Materialien für die Erreichung der Zielbeschrei-bungen der Thüringer Lehrpläne liegt dabei grundsätzlich in Verantwortung der Einzelschule und des jeweiligen Pädagogen.
6. Wer ist an der Schule an der Umsetzung der Konzepte beteiligt?
Die Auswahl der Konzepte, Methoden und Materialien für die Erreichung der Zielbeschreibungen der Thüringer Lehrpläne liegt grundsätzlich in Verantwortung der Einzelschule und des jeweiligen Pädagogen.
Im Rahmen der schulinternen Lehr- und Lernplanung konzipieren die unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer einen stimmigen Lehr- und Lernprozess, in dessen Verlauf die Kompetenzen im Sinne kumulativen Lernens klassenstufen- sowie schulartübergreifend entwickelt werden können.
Hierbei haben die schulischen Gremien verschiedene Verantwortlichkeiten:
-
Die Lehrerkonferenz hat die Aufgabe, über alle wichtigen Fragen der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit der Schule zu beraten und zu beschließen.
-
Die Fachkonferenz, bestehend aus allen Lehrern, die das Fach unterrichten, erörtert die didaktischen und methodischen Fragen des Faches.
-
Die Schulkonferenz, bestehend aus Eltern- und Lehrervertretern sowie dem Schulleiter, wirkt bei der Entscheidung über die Einführung neuer Schulbücher, schulbuchersetzen-der Lernsoftware und spezifischer Lernmittel mit.









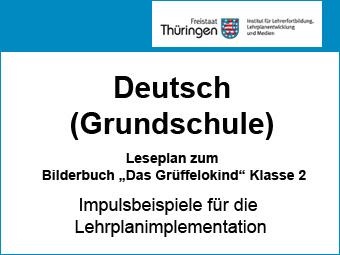


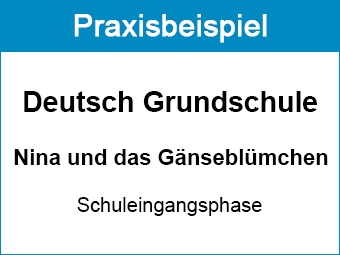

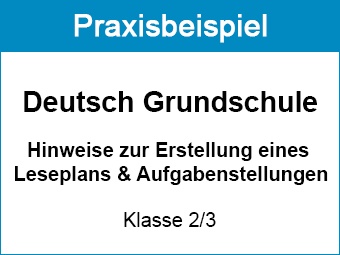

 +49 36458 56-230
+49 36458 56-230 +49 36458 56-300
+49 36458 56-300